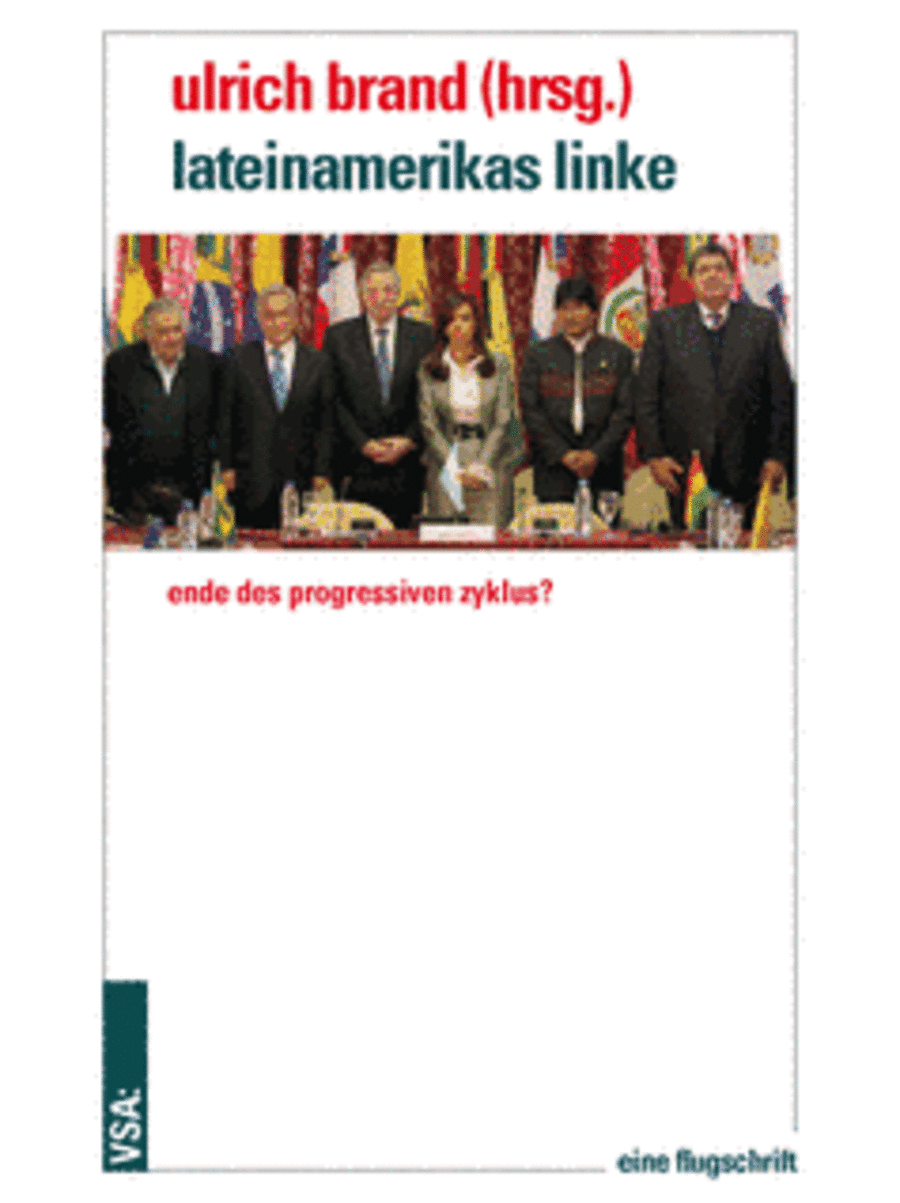"Niemand weiß, wie es weiter geht"
| 21. November 2017
Venezuela war dank seiner reichen Ölvorkommen lange Zeit das reichste Land Südamerikas. Heute reicht das Geld oft nicht mal mehr für Lebensmittel. Bild: Venezuelas Hauptstadt Caracas. (Foto: Efecto Eco/wikimedia.org CCBY 3.0).
Venezuela – einst reichstes Land Südamerikas – steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die Inflation steigt, Lebensmittel und Medikamente werden knapper. Mit uni:view spricht Politikwissenschafter Ulrich Brand über die Not der Gesellschaft, autoritäre Regierungen und politische Lösungen.
uniview: Herr Brand, Sie waren Anfang November in Caracas. Welche Eindrücke haben Sie in Venezuela gewonnen?
Ulrich Brand: Die gesellschaftliche Situation ist dramatisch. Vor Ort herrscht eine Hyperinflation. Im letzten Jahr gab es eine Inflation von 800 Prozent, dieses Jahr sind es wahrscheinlich schon 1500 Prozent. Das heißt, das Gehalt ist nichts mehr wert und immer mehr Menschen verlassen den formellen Arbeitsmarkt, weil der Mindestlohn aktuell umgerechnet nur mehr acht Dollar beträgt. Für Arme ist es besonders schwierig, den Alltag zu organisieren und an Lebensmittel heranzukommen.
uniview: Versuchen die BewohnerInnen das Land zu verlassen?
Brand: Schätzungen zufolge sind zwei bis drei Millionen Menschen in den letzten Jahren nach Kolumbien, Ecuador, Panama und in die USA emigriert. Genaue Zahlen sind allerdings schwer zu benennen, da viele auch über die "grüne Grenze" gehen. Auch darin zeigt sich die Hoffnungslosigkeit der Gesellschaft. Niemand weiß genau, wie es weitergeht oder was die Lösung ist.
uniview: Wie ist die derzeitige politische Situation in Venezuela?
Brand: Politiken und Diskurse der Regierung sind sehr autoritär. Die Regierung spricht sich selbst Mut zu, macht aber keine angemessene Wirtschaftspolitik. Es gibt eine unglaubliche Korruption und das Militär ist inzwischen wirtschaftlich zu einem ganz starken Akteur geworden. Diese Umverteilung an Wenige führt zu Frustration. Allerdings muss man sagen, dass die rechte Opposition auch keine guten Vorschläge hat; die alten Eliten wollen einfach wieder an die Ölrenten.
uniview: Können Sie kurz erklären, wie es zu dieser schweren politischen und sozialen Krise gekommen ist?
Brand: Kurz nach dem Tod von Hugo Chavez im März 2013 gewann Nicolas Maduro knapp die Wahl zum Präsidenten. Er repräsentiert die Regierungspartei – die sozialistische Partei Venezuelas. Die damalige Opposition, die Mesa de la Unidad Democrática – der Tisch der demokratischen Einheit – hat ihn als Präsidenten akzeptiert und Maduro kam an die Macht. Doch parallel fiel der Ölpreis stark und die wirtschaftlichen Bedingungen wurden schlechter. Im Dezember 2015 gewann die Opposition haushoch die Parlamentswahlen und das war der "turning point".
Damals hat die Regierung unter Maduro offensichtlich die Entscheidung getroffen, dass sie ihre Macht unbedingt erhalten will und notfalls auch die Ergebnisse demokratischer Wahlen nicht akzeptiert. Es kam zu einem lähmenden Kampf zwischen Regierung und Opposition. Maduro hat Anfang 2016 den Ausnahmezustand erklärt mit dem Argument, es gäbe einen "ökonomischen Krieg" – una guerra económica – gegen Venezuela. Als die Opposition 2016 versuchte, Maduro per Referendum abzusetzen, hat dieser die Abhaltung des Referendums so lange hinausgezögert, bis es nicht mehr durchgeführt werden konnte. Und das führte schließlich im Frühjahr 2017 zu massiven Protesten. Die ganz rechten Kräfte innerhalb der Opposition, welche die Regierung notfalls gewalttätig stürzen wollen, haben sich durchgesetzt. Schließlich wurde im Juli 2017 auf Initiative Maduros eine neue verfassungsgebende Versammlung gewählt, die de facto das Parlament ersetzt, in dem die Opposition ja in der Mehrheit war. Zwar hat Maduro wahrscheinlich so eine weitere Zuspitzung und vielleicht sogar einen Bürgerkrieg verhindert, aber um den Preis einer zunehmenden Autoritarisierung.
uniview: Würden Sie Venezuela als Diktatur bezeichnen?
Brand: Nein. Venezuela ist ein autoritäres Regime, das immer autoritärer wird, aber keine Diktatur. Obwohl Chavez gesagt hat, sie wollen nur eine Partei, und zwar die sozialistische Partei, sind Oppositionsparteien ja trotzdem zugelassen. Außerdem hat der Begriff der Diktatur in Lateinamerika starke Konnotationen mit den meist brutalen Militärdiktaturen der 1970er Jahre.
uniview: Was macht diese verfassungsgebende Versammlung jetzt?
Brand: Die verfassungsgebende Versammlung ist trotz Protesten des Parlaments in dessen Räume gezogen und macht auch Gesetze. Das heißt, sie macht etwas Verfassungswidriges, weil sie sich eigentlich um eine neue Verfassung kümmern sollte. Maduro sagte einmal, dass seine Regierung keine Wahlen mehr ausschreiben werde, die sie nicht gewinnen werde. Das ist eine unglaublich undemokratische Aussage. Momentan ist aber niemand in der Lage, die Regierung einzubremsen. Die Opposition ist schwach und das Militär ist immer noch pro Regierung. Aus einem einfachen Grund: die Regierung beteiligt das Militär offensichtlich an den Fleischtöpfen, d.h. der Ölrente. Und dort wollen alle hin.
uniview: Von den meisten Staaten wird diese Versammlung nicht anerkannt – hat das einen Einfluss auf die Gesetzgebung im Land?
Brand: Nein, das Land ist sehr in sich zurückgezogen, was mich auch überrascht hat. In den offiziellen Medien wird alles mit der erwähnten "guerra económica" begründet. Alle Aktionen von außen werden diesem vermeintlichen Krieg untergeordnet. So auch die politischen Sanktionen der USA. Wie das in der Bevölkerung ankommt, kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber Selbstkritik der Regierung hört man nicht. Tatsache ist aber: wenn die USA richtige Sanktionen hätte setzen wollen, hätten sie das Öl sanktioniert.
uniview: Gibt es neben Sanktionen noch andere politische Mittel, die momentan denkbar sind?
Brand: Sanktionen haben etwas Ambivalentes, weil Wirtschaftssanktionen hauptsächlich die Schwachen treffen und nicht die Eliten oder jene, die Zugang zu Dollars haben. Das wissen wir aus vielen Untersuchungen und historischen Erfahrungen. Dazu kommt: Die Regierung kann zum Schulterschluss aufrufen – "die sind gegen uns". Wenn ich die EU beraten könnte, würde ich Gesprächsangebote auf der informellen Ebene empfehlen, um aus dieser völlig verfahrenen Situation rauszukommen. Vielleicht findet das ja auch statt. Es müsste wahrscheinlich auch bald Hilfslieferungen geben. Das wird die Regierung vielleicht ablehnen, wenn das zu öffentlich geschieht. Aber es sollte vorbereitet werden, falls die Versorgungslage schlimmer wird.
uniview: Die EU hat ihre Sanktionen auf Waffenexporte beschränkt. Ist das ein Schritt, der helfen kann?
Brand: Das ist nur Symbolpolitik und irgendwie lächerlich. Die EU müsste, wie gesagt, auf einer nichtöffentlichen Ebene Aktivitäten entwickeln. Es muss eine verhandelte Lösung geben und die wird mittelfristig vielleicht ohne Maduro passieren. Aber man kann das Land nicht nur sich selbst überlassen, denn die Situation wird immer katastrophaler.
uniview: Können Statements wie die Verleihung des Sacharow-Preises vom EU-Parlament an die Opposition in Venezuela die politische Lage beruhigen?
Brand: Im Gegenteil, das zeigt eher die Polarisierung. Ich halte die Opposition nicht wirklich für demokratisch. In der internationalen medialen Wahrnehmung sind das die Guten, aber sie haben schon im Frühjahr gezeigt, wie sie sind. Es sind oft die alten Eliten, die an die Fleisch- bzw. Öltöpfe wollen. Das Parlament hatte beispielweise gegen die geltende Verfassung beschlossen, Maduro abzusetzen. Ich will damit die Regierung nicht gut reden – aber auch mit der Opposition sollte das nicht gemacht werden. Es gibt Schätzungen, dass etwa 60 Prozent der Bevölkerung weder für die Regierung noch für die Opposition sind. Es gibt viele zivilgesellschaftliche Aktionen. Im Rahmen einer Forschungsgruppe haben wir uns in Venezuela nicht nur mit kritischen Intellektuellen, einige davon waren früher Minister, sondern auch mit Basisgruppen, sozialen Bewegungen getroffen. Diese Leute arbeiten etwa daran, den Ernährungsnotstand zu verhindern. Es ist wichtig, diese Leute zu stärken.
uniview: Maduros Vorgänger Hugo Chavez rief 2006 den Sozialismus des 21. Jahrhunderts aus. Wie unterscheidet sich dieser vom Sozialismus des 20. Jahrhundert?
Brand: Der Unterschied zum Realsozialismus des 20. Jahrhunderts, den es bis heute in China gibt, ist die Pluralität. Es gibt Wahlen und es gibt eine Verfassung, die Parteienkonkurrenz zulässt. Das wird erst jetzt in der politischen und wirtschaftlichen Krise eingeschränkt. Aber im Grunde ist es kein demokratischer Sozialismus, der aus der Gesellschaft kommt. Das hat Chavez anfangs durchaus versucht, aber dann haben sich bürokratische Logiken durchgesetzt. In Lateinamerika, und auch in Venezuela, dominiert in den letzten Jahren zudem ein schwarz-weiß Denken: Bist du nicht für mich, bist du gegen mich.
Die Kritik am Chavismus, die nicht von rechts kommt, ist mundtot gemacht worden. Teilweise werden populäre linke Bürgermeisterkandidaten in Venezuela nicht mehr zugelassen, weil es den Oberen in der sozialistischen Partei nicht passt. Zentral ist in Venezuela heute der Kampf um das Öl – die Staatsrente. Anstatt landwirtschaftliche Ansätze von unten auszubauen oder eine eigene Industrie zu stärken, damit weniger importiert werden muss, werden diese eher geschwächt. Alles wird über den Zugang zum Öl geregelt. Ein demokratischer Sozialismus müsste die Eliten und die großen Privatvermögen in ihrer Macht beschneiden, vor allem die Menschen ermächtigen und den Staat demokratisieren.
Die Forschungsgruppe "Alternativen zu Entwicklung" befasst sich seit 2011 mit den Auswirkungen der starken politischen und wirtschaftlichen Orientierungen in Lateinamerika an den nördlichen Ländern und am Weltmarkt, was oft den Aufbau eigener Wirtschaftsstrukturen verhindert. Der Gruppe gehören gut 60 Personen an. Sie trifft sich einmal jährlich, in der Regel in Quito. In seiner 2016 erschienenen erschienen Publikation "Lateinamerikas Linke" arbeitet Brand die letzten 20 Jahre in einigen Ländern anhand von Interviews auf. (Foto: VSA Verlag)
uniview: Kann sich Venezuela wirtschaftlich erholen?
Brand: Venezuela hat seit Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem auf Öl gesetzt, was es viele Jahrzehnte zu einem wirtschaftlich prosperierenden Land machte. Doch es wurde versäumt, eine alternative Produktionsstruktur aufzubauen. Man spricht von einer tief verankerten cultura petrolera (Kultur des Öls), die Menschen erwarten eine Umverteilung der Ölrente. Es ist ein Drama, dass dieses karibische Land etwa keine intensive Landwirtschaft hat. Im Februar 2016 hatte Maduro verkündet, wenn der Ölpreis sinkt, wird der Groß-Bergbau gefördert. Jetzt gibt es im Süden von Venezuela den sogenannten Arco Minero de Orinoco (Bergbaugürtel von Orinoco) – eine Region fast eineinhalb Mal so groß wie Österreich, wo internationale Konzerne investieren sollen. Wegen der Rechtsunsicherheit kommt allerdings bisher niemand. Doch das ist paradox: Man beantwortet die Krise des Ressourcen-Extraktivismus mit mehr Ressourcen-Extraktivismus, unter anderem in indigenen Gebieten, in biodiversitätsreichen Gebieten, in Süßwassergebieten. Eine Regierung, die sich ernst nimmt, muss den Produktionsapparat umbauen und diversifizieren. Dass ein so großes Land mit so vielen Möglichkeiten den Großteil seiner Lebensmittel importieren muss, ist ein Skandal.
uniview: Die EU fordert neue freie Wahlen. Ist das ein möglicher politischer Lösungsweg?
Brand: Ich denke, in der aktuellen Situation ist damit nicht viel gewonnen. Es muss eine paktierte Lösung geben. Ob die aktuellen Spitzen von Regierung und Opposition dann das Sagen haben werden, weiß ich nicht. Am Ende der Verhandlungen kann eine Wahl stehen, wenn sich die Verhältnisse stabilisiert haben. Es gibt Einschätzungen, denen zufolge die Opposition ganz froh ist, dass es keine Wahlen gibt, denn sie käme als Regierung in eine sehr schwierige Situation, müsste etwa den stark gewachsenen wirtschaftlichen und politischen Einfluss des Militärs zurückdrängen. Sie hat zwar durchaus den Wunsch an die Ölrente zu kommen, aber sie würde sich auch einige Probleme einhandeln. Wie es in Venezuela weitergehen wird, weiß niemand.
uniview: Das Wissenschaftsministerium finanziert Ihnen ab Dezember für zwei Jahr den Aufbau einer Forschungsgruppe Lateinamerika. Was sind Ihre Ziele?
Brand: Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, die unsere bislang geleistete Arbeit anerkennt. Neben der Fortführung der jährlichen Lateinamerika-Tagung im Mai in Strobl am Wolfgangsee und jährlich fünf Stipendien für jüngere WissenschafterInnen aus Lateinamerika geht es mir vor allem darum, die wissenschaftliche Community in Österreich, die zu Lateinamerika arbeitet, zu stärken. Das wird über intensivere internationale Kooperationen, aber auch über Anträge auf Drittmittelprojekte erfolgen. Dazu möchte ich einen wissenschaftlichen Beirat einrichten, um möglichst viele Forschende zu involvieren. Seit dem letzten Sommersemester haben wir ein monatlich stattfindendes Forschungskolloquium zu Lateinamerika. Es nehmen unerwartet viele Menschen teil und wir haben dafür einen wichtigen Diskussionsraum geschaffen.
uniview: Vielen Dank für das Gespräch! (pp)

Ulrich Brand ist seit September 2007 Professor für Internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen u.a. kritische Analysen der Globalisierung und ihrer politischen Regulierung, Ökologische Krise, Global Environmental Governance und sozial-ökologische Transformation mit den Schwerpunkten Ressourcen-, Energie- und Klimapolitik. (Foto: Universität Wien)